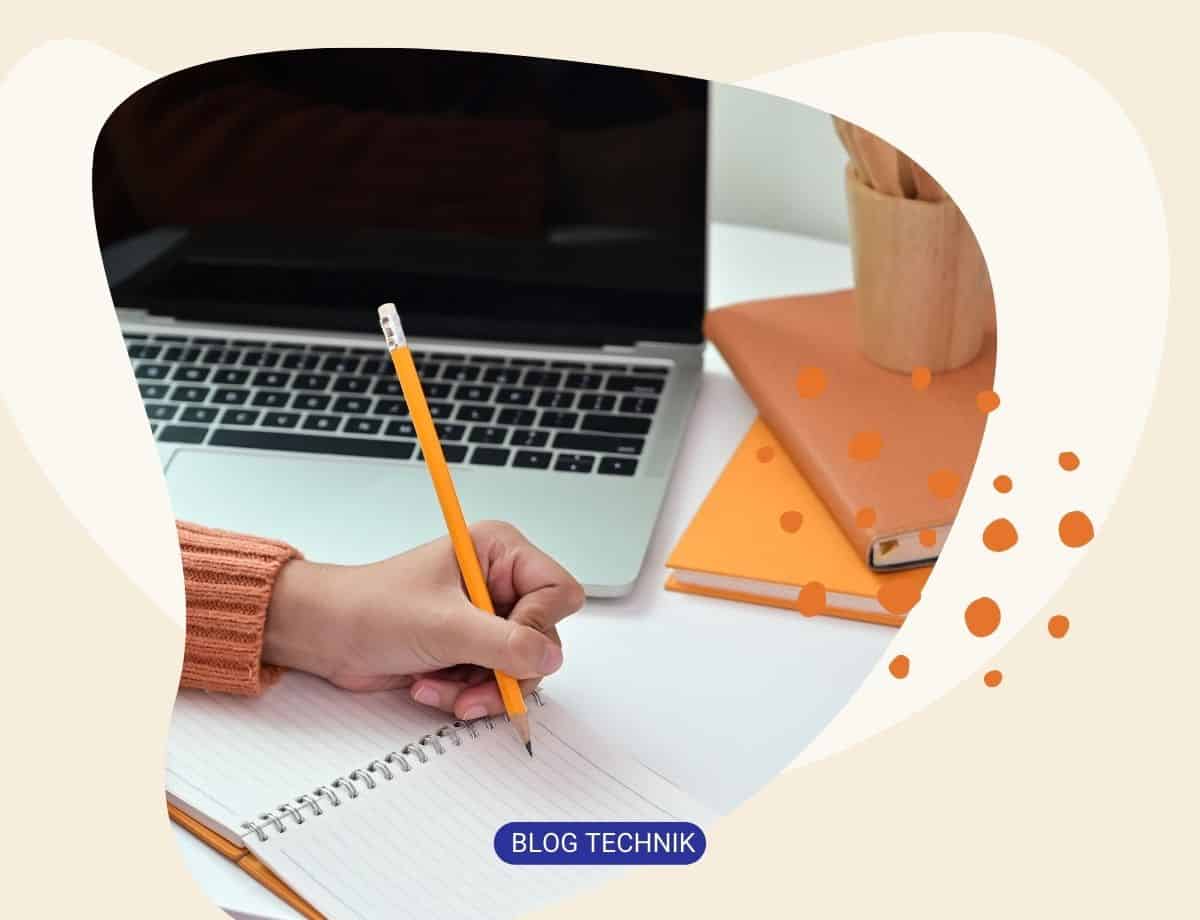Was heißt das eigentlich – indexiert werden? Diese Frage begegnet mir immer wieder. Genauso wie: Was macht ein Crawler? Oder: Warum zeigt mir die Google Search Console so viele nicht indexierte Seiten an?
Wer anfängt, sich mit SEO zu beschäftigen, stolpert ziemlich schnell über Begriffe, die alles andere als selbsterklärend sind. Und genau deshalb habe ich dieses SEO Glossar geschrieben: Es soll dir helfen, endlich Klarheit über die Begriffe zu bekommen, die dir überall begegnen, wenn du bloggst und möchtest, dass deine Inhalte auch gefunden werden.
Kurz, verständlich, ohne Fachchinesisch und mit meiner persönlichen Einordnung für dich: Denn SEO wird leichter, wenn du die Begriffe kennst und weißt, worüber gesprochen wird. Am Ende wirst du sehen: Es ist gar nicht so kompliziert.
Alt-Text – kleines Textfeld mit mehrfacher Wirkung
Der Alt-Text ist eine kurze Beschreibung, die du einem Bild hinzufügen kannst. Ursprünglich wurde er vor allem für Menschen mit Sehbehinderung entwickelt, damit Screenreader vorlesen können, was auf einem Bild zu sehen ist. Doch auch Google schaut sich diesen Text an: Er hilft dabei, Bilder zu verstehen und liefert Informationen, falls das Bild mal nicht geladen werden kann.
💡 Meine Einschätzung: Für den SEO-Start ist der Alt-Text kein Muss. Ich selbst habe ihn anfangs oft übersehen – und das war völlig okay. Heute schreibe ich Alt-Texte bewusst, weil ich meine Inhalte möglichst barrierearm gestalten will. Und es dauert wirklich nur ein paar Sekunden.
Anker-Text – der klickbare Teil eines Links
Der Anker-Text ist der Text, auf den du klickst, wenn du einen Link in einem Blogartikel oder auf einer Website siehst. Oft ist er blau und unterstrichen und führt dich zu einer anderen Seite, einem anderen Blogartikel oder springt an eine andere Stelle vom Text. Beispiel: Statt „Mehr Infos findest du hier“ wäre ein besserer Anker-Text: „So planst du einen Familienurlaub in Südtirol“. Das sagt sowohl deinen Leserinnen und Lesern als auch Google viel mehr über das Ziel des Links.
💡 Mein Tipp: Verlinke sinnvoll und beschreibend. Ich versuche, Anker-Texte so zu formulieren, dass man schon beim Lesen weiß, worauf man klickt.
Backlink – wie eine Empfehlung unter Webseiten
Ein Backlink ist nichts anderes als ein Link von einer anderen Website zu deiner. Und genau wie eine persönliche Empfehlung zählt auch dieser Link als ein Vertrauenssignal. Nur eben für Google. Wenn jemand auf dich verlinkt, heißt das sinngemäß: „Diese Seite ist hilfreich – schau sie dir an!“ Je mehr solcher Empfehlungen du bekommst (und je vertrauenswürdiger die verlinkende Seite ist), desto besser für dein Ranking.
💡 Meine Erfahrung: Ich habe festgestellt, dass Backlinks oft ganz natürlich entstehen. Zum Beispiel, wenn du Gastbeiträge für andere Blogs schreibst, mit anderen Bloggerinnen kooperierst oder Inhalte erstellst, die wirklich weiterhelfen und von anderen Website-Betreibern verlinkt werden.
Crawler unterwegs im Netz – so finden sie deine Website
Damit Google überhaupt weiß, welche Inhalte es seinen Nutzerinnen und Nutzern zeigen kann, muss es erstmal rausfinden, was im Internet so alles existiert. Genau dafür gibt es sogenannte Crawler. Das sind automatisierte Programme, die sich selbständig durch Webseiten klicken. Diese Crawler folgen Links von Seite zu Seite (so wie ich beim Stöbern im Netz) und sammeln dabei massenhaft Informationen: Worum geht’s auf der Seite? Wie ist sie aufgebaut? Ist sie übersichtlich und nutzerfreundlich? Das alles landet im Google-Index. Diesen ganzen Vorgang nennt man Crawling. Ohne Crawling gäbe es keine Suchergebnisse in Suchmaschinen wie Google.
💡 Mein Tipp: Wenn du wissen willst, ob der Googlebot (so heißt der Crawler) schon auf einer bestimmten Seite oder einem Blogartikel war, kannst du das ganz einfach in der Google Search Console prüfen. Geh dort auf „URL-Prüfung“, gib die Adresse (URL) deiner Seite oder deines Blogartikels ein, und du bekommst Infos wie: Wurde sie gecrawlt? Wann zuletzt? Ist sie indexiert?
EEAT – warum Google wissen will, wer du bist
EEAT steht für Experience, Expertise, Authoritativeness & Trustworthiness – also Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Früher hieß das Ganze nur EAT (ohne das erste E), aber Google hat gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob jemand etwas nur theoretisch weiß oder es selbst erlebt hat. Gerade bei Themen wie Gesundheit, Erziehung oder Finanzen achtet Google besonders darauf, wer den Inhalt geschrieben hat und ob dieser glaubwürdig ist.
💡 Meine Sicht: Ich finde es gut, dass Google echte Erfahrungen wieder stärker wertschätzt. Als Bloggerin bist du oft genau das: jemand mit echter Erfahrung. Du musst keine „Expertin auf dem Papier“ sein, wenn du aus der Praxis schreibst, zum Beispiel über Podcast-Technik, Kinderbücher oder Familienreisen. Wichtig ist nur: Mach dich sichtbar. Zeig, wer du bist.
👉 Und vor allem: Bleib nicht an der Oberfläche. Je tiefer und hilfreicher dein Content ist, desto mehr zeigst du automatisch deine Erfahrung, dein Fachwissen und damit auch deine Vertrauenswürdigkeit.
Evergreen Content – Inhalte, die nicht verwelken
Evergreen Content ist wie deine Lieblingsjeans: zeitlos und passt irgendwie immer. Es sind Inhalte, die dauerhaft relevant bleiben und das unabhängig von Trends oder Jahreszeiten. Typische Beispiele sind: 10 Tipps, wie dein Kind besser schläft oder So startest du einen Podcast – Schritt für Schritt. Diese Themen werden rund ums Jahr und auch Monate und Jahre später gesucht. Im Gegensatz dazu hat mein Blogartikel Vom Löwenzahn zur Pusteblume – ein Forschungsabenteuer für Kinder auf meinem Familienblog Mama-macht-Abenteuer seine Hochphase in Sachen Sichtbarkeit im Frühling.
💡Mein Tipp: Überlege dir immer wieder Themen, die für deine Leserinnen und Leser auch nächstes Jahr noch spannend sind. Solche Inhalte lohnen sich, da sie nie an Aktualität verlieren.
Google Search Console – dein direkter Draht zu Google
Die Google Search Console (kurz: GSC) ist eines meiner Lieblingstools – und komplett kostenlos. Hier zeigt dir Google, wie es deine Website sieht. Du erfährst zum Beispiel, welche Seiten indexiert sind (oder eben nicht), über welche Suchbegriffe du gefunden wirst, ob es technische Probleme gibt und kannst deine Sitemap einreichen. Gerade am Anfang wirkt die Oberfläche vielleicht etwas nüchtern, aber mit der Zeit wird sie zu einer echten Hilfe.
💡 Mein Tipp: Schau regelmäßig rein, aber lass dich nicht verrückt machen. Wenn mal ein paar Seiten „nicht indexiert“ sind, heißt das nicht automatisch, dass du alles falsch machst. Die Google Search Console ist ein Werkzeug – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du darfst (und du sollst) die Ergebnisse mit gesundem Menschenverstand einordnen.
H-Überschriften – Struktur für dich und für Google
H1, H2, H3 – was klingt wie ein Code für Waschprogramme, ist in Wirklichkeit das Grundgerüst deines Blogartikels. H-Überschriften („Heading Tags“) helfen nicht nur deinen Lesern und Leserinnen, sich im Text zurechtzufinden, sondern zeigen auch Google, worum es auf deiner Seite geht. Ganz grob gesagt: Die H1 ist der Haupttitel deines Beitrags und kommt auch nur ein einziges Mal vor. Im Gutenberg-Editor kannst du gar nichts falsch machen, denn damit startet jeder Beitrag. Die H2 sind die großen Zwischenüberschriften. H3, H4 usw. unterteilen deinen Textabschnitt unter der H2 nochmal, falls du’s brauchst – und so weiter bis H6 (wobei das kaum jemand nutzt).

💡 Meine Erfahrung: Ich achte mittlerweile beim Schreiben direkt auf eine logische Gliederung mit H-Tags. Nicht nur, weil Google das mag, sondern weil es auch mir hilft, klarer zu schreiben.
Indexierung – wenn deine Seite ins Google-Regal kommt
Wurde meine Seite eigentlich indexiert? Diese Frage taucht früher oder später bei allen auf, die mit SEO starten.
Indexierung bedeutet: Google hat deine Seite „gelesen“ (gecrawlt) und in seinen Suchindex aufgenommen. Erst dann kann sie überhaupt in den Suchergebnissen auftauchen. Du kannst dir das wie ein riesiges digitales Bücherregal vorstellen. Nur die Seiten, die dort einsortiert wurden, kann Google auch als „Treffer“ anzeigen.
💡 Meine Erfahrung: Nicht jede Seite wird automatisch indexiert. Manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal entscheidet Google auch, dass eine Seite (noch) nicht relevant genug ist. Ich schaue regelmäßig in der Google Search Console nach, ob meine wichtigsten Seiten und Blogbeiträge im Index sind. Und wenn nicht? Dann überarbeite ich sie oder reiche sie manuell ein.
Keyword – das Herzstück deiner Inhalte
Ein Keyword ist das Wort (oder die Wortgruppe), das jemand bei Google eintippt, wenn er oder sie etwas Bestimmtes sucht. So einfach – und gleichzeitig so wichtig. Wenn du zum Beispiel einen Blogartikel über Familienurlaub in Südtirol schreibst, könnte dein Keyword genau so lauten. Oder auch: Wanderschuhe für Kinder in Südtirol kaufen – je nachdem, worauf du den Fokus legst. Google zeigt deine Seite oder dein Blogartikel zu dem Thema dann idealerweise den Menschen, die genau das suchen. Aber nur, wenn du dem Suchbegriff auch Raum gibst: im Titel, in Zwischenüberschriften, im Text selbst – und zwar so, dass es natürlich klingt.
💡 Meine Erfahrung: Ich denke beim Schreiben nicht ständig an „Keyword-Platzierung“, aber ich frage mich immer: „Was würde jemand googeln, um genau diesen Inhalt zu finden?“ Das hilft mir, wie auch die H-Überschriften, den Text klar zu strukturieren.
Meta Description – der Mini-Text, der Klicks bringt (oder bringen sollte)
Die Meta Description ist der kurze Text, den du in den Suchergebnissen von Google unter dem Titel siehst – also noch bevor jemand deine Seite überhaupt anklickt. Sie wird nicht auf deinem Blog angezeigt, sondern im Hintergrund hinterlegt. Du kannst mit dieser kleinen Beschreibung Leserinnen und Leser neugierig machen und zeigen, dass dieses Suchergebnis für sie genau richtig ist.
💡 Mein Tipp: Ich formuliere Meta Descriptions wie eine Einladung: kurz, klar, mit dem Fokus auf die Suchintention.
Aber Achtung: Seit Google verstärkt auf KI-generierte Suchergebnisse setzt (Stichwort: „AI Mode“), werden Meta Descriptions seltener komplett angezeigt – und der Traffic kann darunter leiden. Trotzdem schreibe ich sie bewusst als Mini-Werbung für meinen Beitrag. Es kostet mich kaum Zeit, aber manchmal bringt’s den entscheidenden Klick.
OffPage-Optimierung – was außerhalb deiner Website passiert
Bei OffPage-Optimierung dreht sich alles um das, was nicht direkt auf deiner Website passiert, aber trotzdem dein Ranking bei Google beeinflusst. Vor allem geht es um Backlinks: also darum, wie viele andere Seiten auf dich verlinken und wie vertrauenswürdig diese Seiten sind. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie beim Netzwerken: Je öfter dein Name in guten Kreisen genannt wird, desto eher wirst du als Expertin wahrgenommen.
💡 Meine Sicht: Ich sehe OffPage-Optimierung nicht als „Marketing-Taktik“, sondern als Ergebnis von echter Verbindung. Wenn du hilfreiche Inhalte schreibst, dich in deiner Nische zeigst oder mit anderen Bloggerinnen kooperierst, entstehen Backlinks oft ganz natürlich.
OnPage-Optimierung – das, was du selbst in der Hand hast
OnPage-Optimierung meint alles, was du direkt auf deiner eigenen Website verbessern kannst, damit Google deine Inhalte besser versteht und sich deine Leserinnen und Leser sich gut zurechtfinden. Dazu gehören zum Beispiel eine klare Struktur (z. B. durch H-Überschriften im Beitragstext), sinnvolle URLs, passende Keywords im Text, Alt-Texte bei Bildern und auch Dinge wie interne Verlinkung oder die Meta Description.
💡 Meine Erfahrung: Ich sehe OnPage-Optimierung nicht als lästige Pflicht, sondern als Teil meines kreativen Prozesses. Wenn ich schreibe, denke ich direkt mit: Wie wird das lesbar, verständlich, nützlich und gleichzeitig suchmaschinenfreundlich? Vieles davon passiert inzwischen automatisch, einfach durch Übung.
Sitemap – der Wegweiser für Suchmaschinen
Eine Sitemap ist wie eine Übersichtskarte für deine Website. Sie zeigt Google (und anderen Suchmaschinen), welche Seiten es gibt, wie sie zusammenhängen und wann sie zuletzt aktualisiert wurden. So wie du deinen Besuchern gern einen guten Überblick gibst, freut sich auch Google über klare Strukturen.
💡 Mein Tipp: Wenn du WordPress nutzt, kannst du mit einem SEO-Plugin (wie Yoast oder Rank Math) die Sitemap automatisch im Tool erstellen. Du musst sie dann nur noch einmal in der Google Search Console hinterlegen und Google weiß Bescheid.
Suchintention – Was will jemand wirklich wissen?
Die Suchintention ist der eigentliche Grund, warum jemand etwas bei Google eingibt. Es geht nicht nur um das Keyword selbst, sondern darum, was die Person, die in das Suchfenster gerade etwas eintippt, sucht, braucht oder vorhat. Beispiel: Wer nach beste Digitalkamera 2025 sucht, will wahrscheinlich erstmal vergleichen und recherchieren. Wer beste Digitalkamera beim Tauchurlaub eingibt, ist wahrscheinlich schon mitten in der Reiseplanung oder kurz davor, sich für ein konkretes Modell zu entscheiden und sucht gezielt nach Empfehlungen und Erfahrungen.
💡 Mein Tipp: Frag dich beim Schreiben immer: Was genau will meine Leserin gerade wissen? Will sie eine Anleitung, eine Inspiration, einen Vergleich, eine Meinung? Wenn du das triffst, machst du es nicht nur Google leichter, sondern bietest auch den berühmten, echten Mehrwert.
Noch Fragen? Oder willst du tiefer einsteigen?
Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, dann speichere ihn dir am besten direkt ab. Wenn du künftig keine neuen Beiträge mehr verpassen willst und von meinen Erfahrungen rund ums Bloggen, SEO, Technik & Content-Strategie profitieren möchtest, dann trag dich gern in meinen Newsletter ein. Ich teile dort regelmäßig Tipps, Learnings – und ab und zu auch ehrliche Einblicke hinter die Kulissen. 👉 Hier zum Newsletter anmelden – Mach’s einfach.